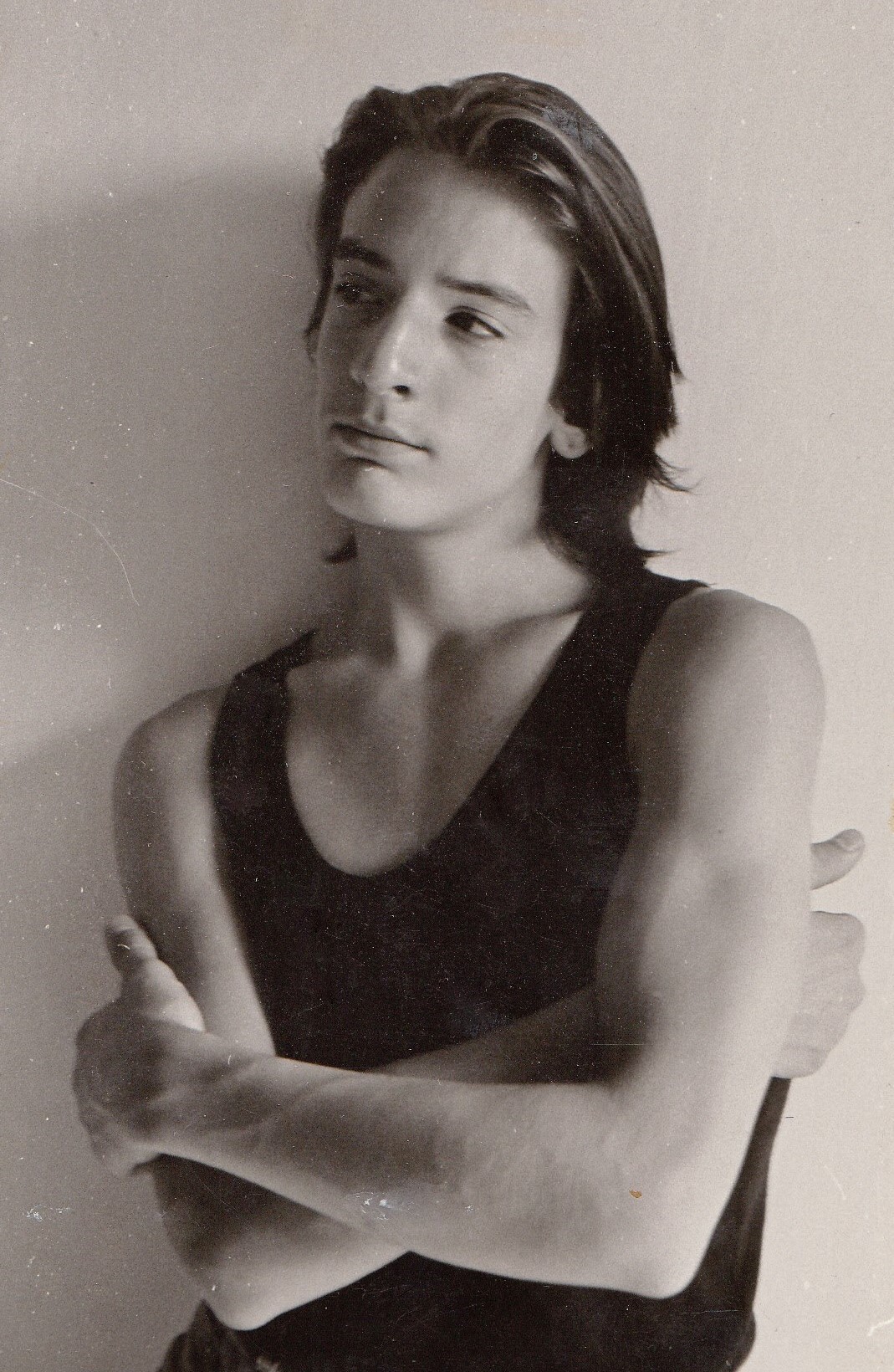Bei den Öffentlich-Rechtlichen muss sich etwas ändern! Wird es aber nicht, weil eine Krähe der anderen nicht die Augen aushackt. Es sei denn, ein entscheidender Dominostein stürzt und reißt alle mit sich. Das wird – noch – nicht passieren. Es hängen zu viel und hängt zu viel dran. Schon allein, dass der ÖRR die kostenlose Achteinhalb-Milliarden-Pressestelle der GrünRoten ist, wird alle im Moment mächtigen Politiker auf den Plan rufen. Das muss erhalten werden! Nur ein bisschen reformieren. Ansonsten ist doch alles prima. Ein paar Köpfe werden rollen, nicht die entscheidenden.
Ich erwarte nichts. Es gibt zu viele, die sich in diesem System öffentlich-rechtlicher Rundfunk eingerichtet haben. Ich weiß, wovon ich rede. Weil ich auch gern eine Sicherheit in diesem System gehabt hätte. Es ist kommod und nervenschonend. Eine feste Stelle im ÖRR ergattern, ist, wie ein Beamtenverhältnis anzutreten oder aber ein Hauptgewinn im Lotto. Ein Hauptgewinn, der monatlich, aber verlässlich, ausgezahlt wird. Egal, was man tut. Auch, wenn man gar nichts tut.
Der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist ein Klassensystem. Menschen erster und Menschen zweiter Klasse. Die Festen und die Freien. Die Festen sind die „Beamten“. Die Freien wiederum teilen sich in die gut Verdienenden, Moderatoren beispielsweise, in die große Masse, die tagtäglich ackernd ums Überleben kämpft, und – in die „Hungrigen“. Sie stehen zu Tausenden vor den „Anstalten“ (des öffentlichen Rechts) und verlangen Einlass. Dafür sind sie bereit, alles zu tun. Bis zum Umfallen arbeiten und alles nachplappern, was der woke Irrsinn gerate gebietet. Heutzutage auch noch Gendern bis zur Lächerlichkeit. Meist oder letztlich glauben sie es wirklich, was sie da reden und schreiben. Das Ziel: Verlässlicher Einlass und später – Festanstellung.
Wenn man nicht gerade mit jemandem aus dem System verwandt oder verschwägert ist, ist der Weg lang und beschwerlich. Einige schaffen es, es sterben ja auch ab und an welche in den oberen Rängen bzw. sie gehen in Rente. Es werden also (zunehmend weniger) Plätze frei – für Günstlinge und Angepasste, für außerordentlich Begabte ganz ganz selten auch. Die Freien sind die Verschiebemasse, mit der man (fast) alles machen kann. Es gibt mutige Freie, begabte Freie, fleißige Freie, auffällige und unauffällige. Viele scheiden wieder aus, weil die Aussichten mies sind und flüchten sich auf Pressestellen oder in Partei-, NGO- und Verwaltungsapparate. Einige wenige gehen den Weg in die wahre Selbständigkeit.
Woher ich das alles weiß? Ich war eine Freie. Von Oktober 1998 bis Dezember 2020. Ich habe alles erlebt. Die (Selbst)Ausbeutung. Das Netzwerken. Das Rausgeschmissenwerden bei dem einen Sender. Das wieder Neuanfangen bei einem anderen Sender. Arbeiten bis zum Umfallen für anfangs wenig, später etwas mehr Geld. Niemals so viel, wie ich wirklich verdient hätte. Ich habe geschwiegen. Ich habe gelogen. Ich habe ab und an gesagt, was ich denke. Ab und an. Ende 2020 habe ich die Reißleine gezogen, als man mir ein Angebot machte, das ich ablehnen konnte.
Ich habe all meine Kenntnisse und Erkenntnisse zunächst beim ORB (Ostdeutscher Rundfunk Brandenburg) in Potsdam, später beim rbb in Berlin gesammelt. Ich befand mich im Auge des Taifuns. Der hieß erst Rosenbauer. Dann Reim. Später Schlesinger. An Rosenbauer kann ich mich kaum erinnern. Reim hatte auch ihre Günstlinge und machte sich noch rechtzeitig aus dem Staub. Schlesinger fiel mir dadurch auf, dass sie einen Rattenschwanz aus dem NDR, aus dem sie kam, hinter sich herzog. Die NDR-„Beamten“ bewarben sich bei uns und wurden eingestellt. Die Vorgänger mussten gehen oder gingen von selbst – falls der Ruhestand nah war. Schlesinger war eben – eine Intendantin. Das machen die auch beim Theater oder in der Oper so, dass die neuen Intendanten – sie haben den gleichen Namen – ihre Vertrauten mitbringen und die anderen gehen müssen.
Eine kleine Arbeitsameise, die ich war – ich schrieb täglich ein Zweiminuten-Rätsel und in der Woche ca. zehn bis fünfzehn Programmtrailer, organisierte noch alles drumherum: Preise für die Rätsel, die Moderationsanweisungen und die Produktion von alledem – bekam nichts davon mit, was Schlesinger und Co. so trieben in ihrem Elfenbeinturm. Es war das „Hochhaus“. Wir Rundfunkleute saßen im Rundfunkhaus, auch an der Masurenallee.
Zu Belegschaftsversammlungen waren Freie nicht zugelassen. Ich habe mir im Laufe der Zeit abgewöhnt, irgendwelche Versammlungen oder Meetings, wie sie später hießen, zu besuchen, zu denen auch die Freien kommen durften. Ich wusste sehr schnell, dass ich an diesem System nichts ändern werde. Ich gehörte nicht zu den Mutigen. Zu den Kämpfern. Denn die gibt es unter den Freien. Ich hätte mich „einklagen“ können, eine Möglichkeit, die solchen Freien, wie ich eine war, noch geblieben wäre, wenn auch da nicht der rbb mit seinen Anwälten schon alle Riegel vorgeschoben hätte, die nur möglich waren, um die Mutigen, die diesen Weg gingen, es gab auch diese, einzuschüchtern und sie – im wahrsten Sinne des Wortes – fertigzumachen.
Einmal habe ich mich auf eine feste Stelle beworben. Es gibt wenig Freie, die das gern und ausschließlich wären, immer hat man die ausgeschriebenen Stellen im Blick. Die Angst, eines Tages vor die Tür gesetzt zu werden, ist groß. Und in den letzten Jahren wurde sie immer größer. Ich bewarb mich auf die Stelle „Leiterin künstlerisches Wort“. Und wurde tatsächlich zum Vorstellungsgespräch eingeladen. Ein Insider, damals bereits in Rente, sagte zu mir, als ich ihm von dem bevorstehenden Vorstellungsgespräch erzählte: „Da haben Sie keine Chance!“ – Ich: „Wieso nicht?“ – Er: „Sie haben doch keine Lobby!“ – Ja. Ich hatte keine Lobby.
Die Angst, vor die Tür gesetzt zu werden. Bei mir war sie in den Nuller-Jahren so groß, dass ich ständig Panikattacken hatte und mich nur noch mit Beruhigungstabletten in der Arbeit hielt. Ich habe diese Zeit ohne jegliche Krankschreibung unter Aufbietung all meiner Kräfte überstanden. Ich ging jede Woche zu einem Psychotherapeuten. Das Ergebnis: Existenzangst. Pure Existenzangst. Freie sind nicht frei. Sie haben Existenzangst. Und das zurecht.
Dass ich es dann schaffte, noch weitere fünfzehn Jahre in diesem System als Freie zu bestehen, war kein Glück. Das war Arbeit. Sehr viel harte Arbeit.
Ich erzähle das, weil es mich ärgert, dass jetzt der öffentlich-rechtliche Rundfunk als Ganzes schlecht gemacht wird. Der ÖRR ist kein Gebilde. Der ÖRR ist nicht Schlesinger oder Buhrow. Der ÖRR – das sind Menschen. Zweierlei Menschen. Die Hälfte sind Verwaltungs- und Managerbeamte. Ein kleiner Teil der Festangestellten ist auch in den Redaktionen tätig. Da gibt es – wie überall Fleißige und (sehr) Faule – weil sie es können. Aber der größte Teil, der Teil, der das Programm macht, sind die Freien. Würden sie für schätzungsweise einen Monat alle, und ich meine ALLE, nicht mehr zur Verfügung stehen, wäre das gesamte Gebilde Öffentlich-Rechtlicher Rundfunk lahmgelegt. Programmlich. Es würde zumindest nichts Neues entstehen und auch die Moderatoren wären alle weg. Denn auch sie sind allesamt Freie. Wie ich schon sagte: Es gibt solche und solche. Auch bei den Freien. Auch da ein Klassensystem. Man kann sich auch in dieser Sparte hochdienen. Allerdings immer mit der nagenden Angst, vom Sockel gestürzt zu werden. Eine Angst, die produktiv oder aber eben angepasst macht. In den letzten Jahren eher das Zweitere. Jeder muss seine Miete und seine Brötchen bezahlen. So ist das eben.
An dieser Stelle beende ich meine Plauderei „aus dem Nähkästchen“. Ich wollte nur das „System“ erklären. Gottseidank nunmehr aus der Außensicht mit Innenkenntnis. Wäre ich noch eine Freie, hätte ich das hier nicht geschrieben bzw. veröffentlicht. Die Frage, warum nicht, erübrigt sich. Lesen Sie noch einmal von vorn.